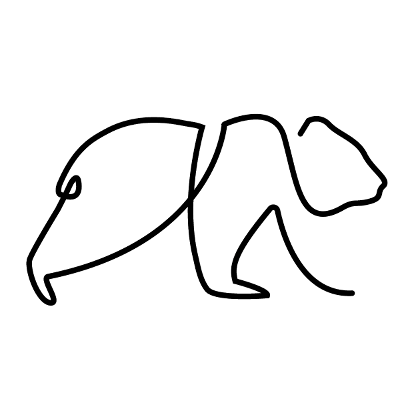Auf der Suche nach alten Klassikern, die jeder kennt und doch wieder nicht, stieß ich auf The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. Überraschend dünn nimmt sich das erstmal 1886 erschienene Werk in meiner deutschen Übersetzung aus. Aufgrund des fast schon sprichwörtlich gewordenen Titels war ich unvorsichtigerweise mal wieder automatisch von einem Tausend-Seiten-Wälzer ausgegangen. Naja, die Masse ist ja meistens nicht entscheidend.
Über die Geschichte sollen nicht viele Worte verloren werden, sie dürfte den meisten bekannt sein. Trotzdem: Beim Lesen eines Textes, dessen Verlauf und Ende man schon kennt, merkt man dann, wie unwichtig eigentlich die Handlung für das individuelle Leseerlebnis sein kann. Mein differenziertes Urteil: Das Buch ist gut.
Man kann die Erzählung von Robert Louis Stevenson (eher bekannt als Autor der Schatzinsel, zumindest mir) als Schauermärchen lesen, über einen Arzt, der aus Anmaßung und übertriebenem Ehrgeiz heraus eine gefährliche Grenze überschreitet, ein bisschen Gott spielt und dadurch ein Monster schafft. Das Monster gerät dann außer Kontrolle, wie so oft, und begeht einen Mord. Das Perfide dabei: Der Protagonist kann keine Rettungsaktion anleiten, da er selbst das Monster ist. Durch die schlimmen Taten hat er selbst Schuld auf sich geladen, was eine Lösung des Konflikts schwierig macht.
Sie kann aber auch gelesen werden als eine über die menschliche Natur. Bezeichnend dafür steht Jekylls Einsicht,
„daß der Mensch in Wahrheit nicht einer ist, sondern tatsächlich zwei.“
Jeder trägt ein Monster in sich, unter Umständen sogar mehr als nur eines. Vielleicht tritt es nicht prügelnd und mordend auf, aber manchmal ist es einfach schön, ihm nachzugeben.
Letzten Endes macht es uns aber das Leben schwer. Jekyll versucht das zu umgehen, indem er seine böse, animalische Seite auslagert. Allerdings verschwindet das Böse nicht einfach aus der Welt, sondern liegt in Gestalt von Edward Hyde sogar konzentriert vor und treibt sein Unwesen. Seine böse Seite abzulehnen, ist also auch keine Lösung. Sie zu zerstören, führt den eigenen Tod herbei.
Auch ein Fitzelchen Kritik an der Gesellschaft im Viktorianischen Zeitalter steckt darin. Denn die ist es schließlich, die den stadtbekannten, hoch angesehenen Arzt Dr Jekyll dazu zwingt, seine Unternehmungslust und charakterlichen Schwächen im Verborgenen auszuleben, und ihn dazu treibt, der Versuchung zu erliegen und das Experiment zu wagen.
Wie schrecklich sich auch alles ausnimmt und wie ekelhaft einem Mr Hyde auch geschildert wird (ich denke, jeder kennt so eine Person, die einem spontan Abscheu empfinden lässt) – das Ende steht trotz aller Gräueltaten positiv da. Denn Hyde, der personifizierte Abgrund, hat Angst vor dem Tod oder, wie es Jekyll ausdrückt,
„Seine Liebe zum Leben ist wunderbar […].“
Er hat trotz des Kontrollverlusts wieder Macht über ihn, denn er kann ihn durch Selbstmord auslöschen. Der „gute“ Jekyll weiß, dass alles zu seinem Ende kommen muss, der „böse“ Hyde dagegen hängt am Leben und wird so verwundbar. Dass sich Hyde dann durch die Einnahme einer Blausäurekapsel selbst umbringt, ist doch ein gutes Ende, oder nicht?