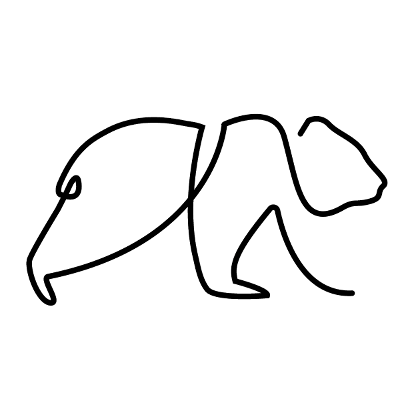Ist Literatur über Behinderungen nur gut, wenn sie den Alltag der Behinderten angemessen wiedergibt? Nein. Wie jede Literatur richtet sie sich an alle.
Was wäre, wenn ich morgen eine Behinderung hätte? Diese unbequeme Frage stellten sich Mitte Januar vier Menschen: die Filmemacherin Doris Dörrie, der Journalist Axel Rühle und die Schriftsteller Lena Gorelik und Frédéric Valin. Es war ein Experiment in der Veranstaltungsreihe „Was geht? Kunst und Inklusion“. So schwierig es ist, im Alltag über Behinderungen zu sprechen – kann man vielleicht darüber schreiben, auch ohne Behinderung? Um die Texte gebeten hatte der Moderator des Abends, Maximilian Dorner, ein Schriftsteller, der oft über Behinderung schreibt.
Ist das Experiment geglückt? Schwer zu sagen. Die Schreibenden hatten damit große Probleme. Zunächst wirkt das merkwürdig. Wer Drehbücher oder Romane schreibt, sollte sich doch auch eine Behinderung ausmalen können. Einfach die Fantasie schweifen lassen, so wie immer. Und Journalisten wie Rühle sollten zwar ihre Fantasie nie zu sehr schweifen lassen, aber auch sie haben Übung darin, Vorstellungen, Gedanken und Erinnerungen klar auszudrücken, sich in Themen zu versenken, die sich sperren.
Trotzdem sagte jeder vor dem Lesen einige entschuldigende Sätze. Es sei natürlich schwierig, es sei vermessen, eigentlich sei es eine unmögliche Aufgabe, aber man habe ja nun dem Abend zugesagt, oh je, man habe… Man sah, wie heikel das Thema ist. Aber das zu hinterfragen, auch das war ein Anliegen des Abends.
An sich ist es ganz klar: Natürlich kann man Literatur über Behinderung schreiben, selbst wenn man selbst keine Behinderung hat. Das geht, weil man über alles schreiben kann. Punkt. Aber: Natürlich kann man es sich nicht vorstellen. Die Vorstellungskraft hat Grenzen. Man kann sich Augen und Ohren zuhalten, in einen Blinden oder Tauben einfühlen kann man sich so aber nicht. Ein Sehender weiß, dass er wieder sieht, wenn er die Augen aufmacht. Eine Frau, die sich beide Beine bricht, weiß, dass sie in zwei Wochen wieder wird laufen können.
Die Schreibenden mussten sich also wie Betrüger fühlen, die eine Übung nur mangelhaft erledigt hatten. Und da jede Übung einen Übungsleiter hat (oder mehrere), mussten sie sich vor denen verantworten. In dem Fall waren das die Menschen mit Behinderungen im Publikum. Die wenigen Meldungen des Abends beschäftigten sich fast ausnahmslos damit, dass irgendetwas in den Texten gut getroffen war, dass sich Menschen darin wiedererkannten. Nachdem Lena Gorelik als Letzte ihren Text über Gehörlosigkeit gelesen hatte, las Moderator Dorner noch eine E-Mail vor. Die hatte er von einem befreundeten Gehörlosen bekommen, der Goreliks Text lobte. Der Text beschreibe sehr gut die Gefühle, die man als Gehörloser haben könne, schrieb der Freund. So bekamen die Texte ein Gütesiegel: „von Menschen mit wirklicher Behinderung für gut befunden“. Alle nicken zufrieden.
Das ist schade, denn das kann nicht alles sein. Ob die Texte gut waren, lässt sich nicht daran messen, ob sie das wirkliche Leben angemessen wiedergeben. Wäre das so, dann dürften etwa allein Kommissare der Kripo darüber urteilen, ob dieser oder jener Tatort gut war. Oder Ärzte über Arztserien. Der Hauptkommissar kann sagen: Ich finde meinen Alltag im Tatort gut wiedergegeben. Ein Arzt klagt, der Bergdoktors sei lächerlich, besagter Doktor habe ja kaum geregelte Sprechzeiten. Ist der Tatort also gute Fernsehunterhaltung, der Bergdoktor nicht?
Filme, Serien, Literatur richten sich nicht nur an Experten, sondern an alle. Warum sollten nur Menschen mit Behinderung darüber entscheiden, was gute Literatur über Behinderung sein soll?Gesteht man Behinderten das ultimative Urteile über Kunst zu, die Behinderungen zum Thema hat, verabschiedet man sich vom Gespräch mit ihnen. Dann klebt man der Kunst ein Etikett an, auf dem steht „Bitte wie Kunst behandeln!“ und stellt noch einen Wachmann dazu, der die Einhaltung streng überwacht.
Sie wird so zur Kunst, die keinerlei Berührungspunkte mit meinem Leben hat, die ich schulterzuckend hinnehmen muss. Inklusion findet dann nicht statt, sondern gerade das Gegenteil. Sicherlich können auch Menschen, die im Alltag nicht behindert werden, interessant davon erzählen, was sie im Umgang mit diesen erleben, was sie denken, welche Angst sie haben. Wie jede ernstzunehmende Literatur wendet sich die Literatur über Behinderung an alle. Jeder darf eine Meinung dazu haben. Nur eine Diskussion muss man dann auch aushalten können.
Bild: Wheelchair on the beach von kris krüg (cc by nc 2.0)