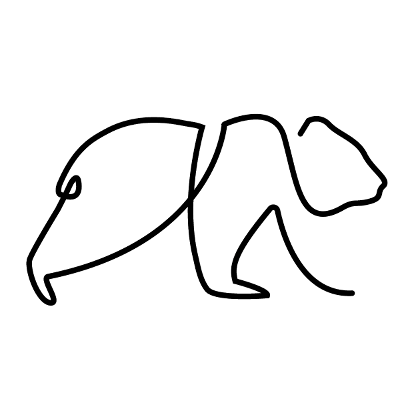Die NSA-Affäre hat enormes literarisches Potenzial. Natürlich zuallererst aufgrund der Handlung. So berichtet etwa der US-amerikanische Journalist Glenn Greenwald in seinem Buch Die globale Überwachung (engl.: No Place to Hide) davon, wie sein erstes persönliches Treffen mit Edward Snowden zustandekam:
„Im dritten Stock, so Laura [Poitras], sollten wir den erstbesten Hotelangestellten, dem wir in der Nähe des vorgesehenen Treffpunkts begegneten, fragen, wo es hier ein geöffnetes Restaurant gebe. Diese Frage wäre für Snowden, der sich in Hörweite aufhalten würde, das Signal, dass uns niemand gefolgt war. In dem bewussten Raum sollten wir auf einem Sofa neben einem ‚Riesenalligator‘ warten, der allerdings nur zur Dekoration diente, wie mir Laura bestätigte.“
Geheime Parolen, Luxushotels, Riesenalligatoren: alles, was ein guter Thriller braucht. Dass Snowden dann auch noch einen Zauberwürfel als Erkennungsmerkmal in der Hand hält und das Ganze in Hongkong stattfindet – geschenkt. Die Affäre hat das Zeug zum Spionagefilm (wenngleich eine Bearbeitung seitens Hollywood wohl noch auf sich warten lassen wird).
Die NSA-Affäre verfügt aber auch noch über ganz andere literarische Qualität. Diese hat nichts mit den konkreten Personen, Details oder Umständen zu tun, unter denen die Dokumente veröffentlicht wurden. Sie ist viel allgemeiner und liegt vielmehr in der Natur der Tätigkeiten von Geheimdiensten begründet, die der des Schreibens und Lesens von literarischen Texten nicht unähnlich ist.
Diese haben den einfachen Traum, alles zu wissen: was Menschen tun, was sie heimlich tun, was sie denken, fühlen und planen. Denn wenn man alles weiß, kann man alles vorhersehen und Katastrophen verhindern, etwa Verbrechen oder im schlimmsten Fall terroristische Anschläge. Im Endeffekt ist die Sicherheit gewährleistet und alle profitieren davon. Dahinter steckt eine sehr deterministische Weltsicht: Alles Kommende ergibt sich aus dem gegenwärtigen Zustand. Schon der französische Mathematiker Pierre-Simon Laplace hatte sie im 18. Jahrhundert in Form seines Dämons präsentiert: Ein Wesen, das in jedem Augenblick bestens über alle Zustände und Gesetze Bescheid weiß, kann alle künftig folgenden Zustände vorhersehen.
Nimmt man das als gegeben und wahr an, ist die lückenlose Überwachung prinzipiell also eine gute Sache – von der Problematik des Eingriffs in die menschliche Privatsphäre mal abgesehen. (Die wollen wir an dieser Stelle mal vernachlässigen.) Vertraut man auf diese Prämissen, ist es nur folgerichtig, den Traum von der Allwissenheit mit Hilfe des Internets oder automatisierten Programmen wie PRISM oder XKeyscore zu verfolgen.
Den Beweis, dass dies alles so funktioniert, können die Geheimdienste aber niemals erbringen. Es kommt schlicht nie so weit, denn das Projekt stößt irgendwann naturgemäß an seine Grenzen. Man kann nie alles wissen. Beispielsweise kann man nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen, Gedanken kann man nicht lesen. Selbst wenn jemand politische Überzeugungen auf Facebook postet, kann man nie wissen, wie das im Einzelfall genau gemeint ist. Ob der- oder diejenige überhaupt offen sprechen konnte, oder ob vielleicht im Augenblick des Postens gerade Eltern/Lehrer/Pfarrer etc. über die Schulter geschaut haben.
Gesammelte Daten können nie ein lückenloses Bild einer Person ergeben. In der Literatur ist das ähnlich: Die echte, äußere Welt in einem Roman wiederzugeben, müsste zwangsweise in einem Buch mit unendlichen vielen Seiten münden. Autoren können nicht gottgleich eine alternative Realität erschaffen, sie müssen selektieren und sich für oder gegen bestimmte Darstellungen entscheiden. Die Parallelwelt entsteht erst in der Vorstellung der Rezipienten, die die vom Autor zwangsweise eingestreuten Leerstellen ausfüllen.
Wer nicht alles weiß, muss Gedankenarbeit verrichten, um nur zufällig gelesenen oder beobachteten Ereignissen – ob das nun zwei sind oder hunderte – einen gemeinsamen Sinn zuschreiben zu können. Literarische Texte und Bewegungsdaten müssen immer interpretiert werden und Interpretationen können fehlgehen oder verfügen zumindest immer über ein subjektives Moment. Dieses geht jedoch den Computern ab, die aufgrund der schieren Datenmenge von Millionen überwachten Nutzern diese Interpretationsleistung vollbringen müssen. Computer verstehen aber keine Ironie oder Wortspiele, können nicht im Subtext lesen und erkennen keine Sinnzusammenhänge – sie können lediglich Text durchforsten (siehe hierzu auch das lesenswerte ZEIT-Dossier).
Ein bärtiger Mann kauft im Baumarkt Napalm, eine Zündschnur und eine Harke – ist er nun ein Terrorist? Oder jemand, der nach Feierabend noch Laub harken und verbrennen möchte? In jedem Fall wäre die Person einem Computer verdächtig. Angst muss man also an sich nicht vor der Vollüberwachung und -erfassung haben. Wenn diese möglich wäre, würde zwar jeder erst einmal unter Generalverdacht stehen, doch dieser könnte bei Unschuldigen in jedem Fall ausgeräumt werden, während potenziell Kriminelle in jedem Fall aufgehalten würden. Die Gefahr besteht vielmehr darin, dass es den Geheimdiensten eben nicht gelingt, zweifelsfrei zu entscheiden. So werden viel eher Unsicherheit und ein Klima der Angst befördert.
Ein neues, lukratives Geschäftsfeld für Geisteswissenschaftler eröffnet sich hier aber eher nicht. Die besseren Spione als IT-Spezialisten oder Mathematiker wären sie auch nicht. Ein vorsichtiger Hermeneut ließe sich nie auf die unerfüllbare Forderung nach der einen, „richtigen“ Interpretation ein. Die meisten von ihnen haben da anderes zu tun. Aber fragen hätte man ja mal können.
Nachtrag: Urs Hafner illustriert in der NZZ anhand eines Beispiels, dass mit großen Datensammlungen allein an sich nichts anzufangen ist und diese der Interpretation bedürfen.
Bild: Sherlock shadow von Flickr-User sake028 (unter CC BY-NC-SA 2.0)