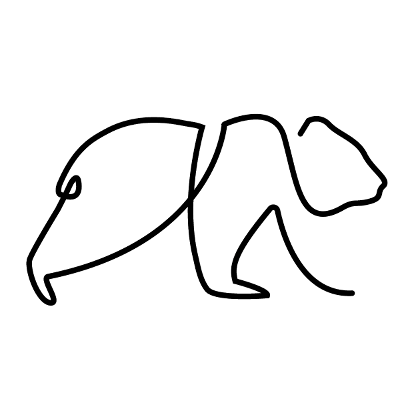Macht es Bücher besser, wenn jemand Kreatives Schreiben studiert hat? Zwei amerikanische Forscher haben herausgefunden: Nein. Schade, aber musste ja so kommen.
Früher™! Wir hatten ja nichts, aber gerade drum war vieles besser. Brezen gab es nicht aus dem Schnellbackofen, und trotzdem waren sie ofenfrisch, oft tagelang. Fußballer waren trickreich und wendig, weil sie alles auf der Straße lernten und nicht in Internaten. Und Schriftsteller schrieben wunderbare Bücher, einfach weil sie lebten und dabei gut aufpassten.
Und heute? Wer schreiben will, kann das in Kursen lernen. Oder sich an den Unis in Leipzig oder Hildesheim einschreiben und Kreatives Schreiben studieren. Oder in den USA einen „master of fine arts“ (MFA) machen. Kritiker sagen: Feinsinnige Kunst kann man weder lehren noch lernen. Und wenn doch, dann nicht so. Die Institute produzieren also nicht mehr als solide, aber einfallslose Massenware.
Der Anglist Richard Jean So von der Universität Chicago und der Literaturwissenschaftler Andrew Piper von der Universität Montreal wollten es aber genauer wissen. Irgendetwas muss es mit dem MFA doch auf sich haben. Irgendwo muss sich doch ein Effekt auf die Literatur ablesen lassen. „Warum sonst würden so viele Menschen für diese Studiengänge zahlen?“, schreiben sie in ihrer Untersuchung.
Die Forscher haben Romane von 20 Autoren, die einen MFA haben, mit den Romanen von 20 „normalen“ Autoren verglichen, also Autoren, die keinen haben. Beziehungsweise: Jean So und Piper haben ihren lernfähigen Computer damit gefüttert und diesen dann alles auf Wortwahl, Stil, Thema, Handlungsorte etc. hin abklopfen lassen. Damit sollte dann geklärt werden, wer die besseren Bücher schreibt.
Was? Aber Romane bestehen doch aus viel mehr als nur aus diesen Teilen! Was einen Roman zu einem großen Roman macht, ist doch… Halt, jaja. Das ist den beiden schon auch klar. Zitat:
„Es ist vollkommen klar, dass Romane aus viel mehr bestehen als nur diesen Teilen. Was einen Roman zu einem großen Roman macht, also was, sagen wir, Junot Diaz [ein US-amerikanischer-dominikanischer Schriftsteller] wie Junot Diaz klingen lässt, ist natürlich größtenteils nicht messbar. Aber diese Bestandteile bleiben die fundamentalen Bausteine eines Romans. Sollten sich also die MFA-Bücher insgesamt von den Büchern der Autoren ohne MFA unterscheiden, sollte das zumindest in Ansätzen auf dieser untersten Prosaebene erkennbar werden.“
Kann das klappen? Kann der Computer mehr, als nur stur Wörter zu zählen? Und lässt sich überhaupt etwas über die literarische Qualität sagen – wo doch der kritische Punkt nicht zu fassen ist, an dem ein Text zu guter Literatur wird?
Natürlich nicht. Und das wissen auch die Forscher, die sich trotzdem den Spaß gönnen. Es geht los mit der Auswahl der Schreibenden, die alles andere als repräsentativ ist:
„Um die beiden Gruppen so vergleichbar wie möglich zu machen, haben wir nur Romane von Autoren ohne MFA ausgewählt, die in der New York Times besprochen wurden. Das nahmen wir als Ausweis literarischer Qualität.“
In der Literaturredaktion der NYT sitzen aber auch nur wieder Menschen mit Vorlieben, Abneigungen und Geschmäckern. Letztlich könnte die Studie eher Aufschluss darüber geben, welche Romane die Redaktion gut findet, nicht aber, ob sich unter den Autorengruppen ein signifikanter Unterschied ergibt. Egal. Der Computer spuckt erstaunliche Beobachtungen aus:
„Die Autoren mit MFA konzentrieren sich eher auf Vorgärten, Seen, Tresen, Mägen und Handgelenke. Sie bevorzugen Namen wie Ruth, Pete, Bobby, Charlotte und Pearl. Autoren ohne MFA scheinen Anna, Tom, John und Bill zu mögen. […] Autoren mit MFA benutzen Adjektivpaare und Adverben eher selten. Auch meiden sie klarere Strukturen wie etwa ein Nomen gefolgt von einem Verb im Präsens.“
Auch die Erwartung wird enttäuscht, dass sich Absolventen von Schreibschulen eher mit den blinden Flecken in der Wahrnehmung von Ethnien und Rassismus beschäftigen würden. Und überhaupt ist die Mehrheit der Protagonisten männlich (Non-MFA: 99%; MFA: 96%; „Das sind in jeder Hinsicht schreckliche Quoten.“)
Das Ergebnis ist am Ende, dass es keines gibt. Die Texte der beiden Autorengruppen unterscheiden sich überhaupt nicht.
„Wenn man es positiv ausdrücken will, könnte man sagen: Die Uni-Abschlüsse helfen den Autoren, sich in die literarische Landschaft einzupassen. […] Im schlechtesten Fall haben die MFAs überhaupt keine Auswirkung.“
Dass sich die Ausbildung nicht mit einem Computer aus den Texten herausfiltern lässt, könnte man am Ende auch gut finden. Oder anders gesagt: Wie oft hat man je von einem Autor gehört, der die Literatur revolutioniert hätte, indem er so tolle andere Wörter verwendet oder seinen Protagonisten fancy Namen gegeben hätte?
Natürlich gibt es mehr schlechte, mehr langweilige Bücher als je zuvor. Das liegt daran, dass es heute von allem mehr gibt als früher. Man muss dieses Mehr vom Gleichen aber nicht den Schreibschulen vorwerfen. Naja, aber wenn man es tut, darf es ruhig unterhaltsam sein.
Bild: Laboratory von Nina (cc by 2.0)