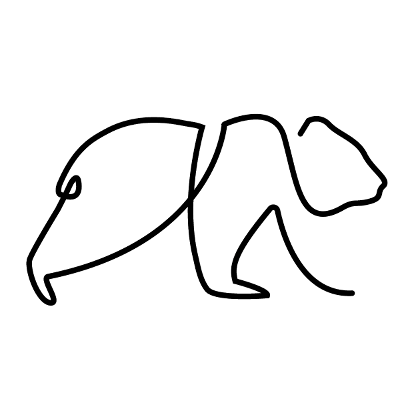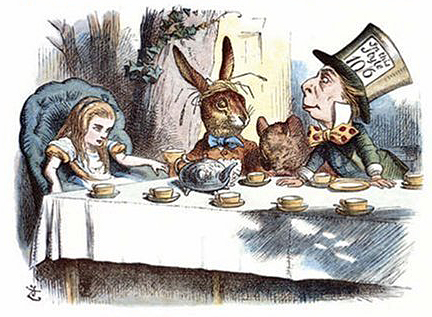Manchmal trägt man Bücher mit sich herum wie uneingelöste Versprechen. Man fängt an zu lesen. Und hört wieder auf. Etwas kommt dazwischen, man gerät aus dem Fluss. Und dann schrecken einen die 600 Seiten wieder ab. Nach drei Monaten ein neuer Versuch. Aber man schafft den Anschluss nicht, man fängt von vorne an. Und hört wieder auf.
Auf Facebook posten Menschen ihre Lese-Competitions. Ende Juni heißt es stolz: Wow, I’ve mastered 40 books this year. Und selbst reißt man sie immer wieder, diese Hürde. Ein merkwürdiges Phänomen stellt sich ein: ein schlechtes Gewissen gegenüber den Figuren. Den Schriftstellern kann es egal sein, wenn man sie nicht liest, die Bücher sind ja bezahlt. Aber was sagt Leyla dazu, die Protagonistin aus dem gleichnamigen Roman von Feridun Zaimoğlu? Ihr Schicksal ist schwer genug. Und dann schaue ich auch noch weg – weil irgendwas dazwischen kommt? Ach Leyla, verzeih mir…
Der Literaturwissenschaftler dagegen sagt: Was sollen sie schon sagen? Nichts sagen sie. Sie existieren ja nicht wirklich, nur auf dem Papier. Bloße Textkonstrukte, das sagt schon das Wort: Figur, von lateinisch figura – Gestalt, aber auch von fingere – vortäuschen. Es hat keinen Sinn, wenn man Worte auf Papier behandelt wie wirkliche Menschen. Zwar ist es nicht unwahrscheinlich, jemanden wie Leyla zu treffen. Und Zaimoğlu hat sich beim Schreiben sogar an seiner Familie orientiert. Und trotzdem: Leyla ist nicht weniger ausgedacht als Alice im Wunderland oder Frodo Beutlin.
Aber man kommt nicht dagegen an, der Verstand füllt die Leerstellen auf. Die Figuren purzeln aus den Büchern, klopfen sich den Staub von den Kleidern. Eine neue Geschichte entsteht. Und wenn man dann noch mehrere Bücher gleichzeitig nicht liest, wird es richtig interessant. Zum Beispiel Truman Capotes Grasharfe und Langer Samstag von Burkhard Spinnen. Dann treffen sich die Hauptfiguren und halten Kaffeekränzchen ab. Leyla, Collin Fenwick und Ulrich Lofahrt plaudern bei gedecktem Apfelkuchen und teufeln auf den faulen Leser ein. Schlimm, dass er es nicht packt, sagt Lofahrt. Collin ist merkwürdig still. Und Leyla gibt die Hoffnung nicht auf.
Ob er es jemals packt? Es ist ein Nachwort im Kopf, ein Drama: manchmal ein Trauerspiel, manchmal eine Komödie. Wissenschaft ist das nicht. Man könnte sagen: Es ist ein Freundschaftsdienst an einer Handvoll Worten. Und damit Quatsch, sicherlich. Aber es ist Quatsch, der einen inniger lesen lässt als die Werkzeuge der LW. Mit den Mikroskopen, Bohrern, Zoom-Objektiven aus dem Lehrbuch bringt man meistens etwas zutage. Aber dem Text und seinen Figuren gegenüber verpflichtet fühlt man sich dadurch nicht.
Im Übrigen: Ich habe es dann doch geschafft. Alle drei. Und ich bin sicher: Selbst wenn nicht, gelästert hätten sie trotzdem niemals. Das hätten sie nicht übers Herz gebracht.
Bild: El sueño de la razón produce monstruos (Francisco de Goya)