Schriftsteller haben Macht über ihre Leser. Natürlich erzählen sie in erster Linie Geschichten, doch dann beschreiben sie auch wieder seitenweise einen Holzstuhl oder lassen sich über die Natur des Staubs aus. Sie schmücken detailreich aus, obwohl viele der Details irrelevant für die Handlung sind. Sie schaffen Spannung. Sie schüren Erwartungen und wenn sie sie enttäuschen, sind meistens auch die Leser enttäuscht. Man merkt daran, dass Texte mehr sind als die in ihnen erzählte Geschichte.
Deutlich wird das zum Beispiel bei Clemens Brentano, einem der bekanntesten deutschen romantischen Autoren. Um die Jahreswende 1800/1801 erschien der erste Band seines Romans Godwi. In der Originalausgabe heißt es auf Seite 266:
„Ich stürze in den Teich.“
Im zweiten Band stößt man später auf folgenden Satz:
„Dies ist der Teich, in den ich Seite 266 im ersten Bande falle.“
Und ist nun erst einmal irritiert. Eigentlich weiß man ja, dass es sich nur um Wörter auf Papier handelt. Trotzdem liest man nie nur mit, sondern erlebt das Gelesene direkt mit und nimmt es oft mit vielen Sinnen wahr. Oder man tut zumindest so oder redet es sich ein. Sätze wie der oben genannte unterbrechen jedoch diese Illusion, egal ob sie von einer Figur der Erzählung oder vom Erzähler selbst geäußert werden. Mit einem Mal dringt der Autor, dringt Brentano selbst in seinen eigenen Roman ein und reißt den Leser ruckartig aus der Illusion. Auch der fiktive Erzähler verfügt offenbar über den real vorliegenden ersten Band des Romans und las wohl beim Schreiben des zweiten Bands darin. Man beginnt, darüber nachzudenken – und entfernt sich immer weiter von der eigentlichen Geschichte. Dabei war es doch gerade noch so schön. Was also soll so etwas?
Nun hat Brentano in einem Brief an Achim von Arnim zwar geschrieben:
„Im Godwi steht mein Schicksal laut geschrieben,… aber ich finde auch drin, daß das ganze Buch keine Achtung vor sich selbst hat,…“
Doch den Godwi einfach als schlechtes Buch abzustempeln, funktioniert auch nicht. Schließlich passiert dergleichen in vielen anderen Werken, immer und überall. Man muss Godwi nicht mögen, nicht aber aus dem Grund, weil er hier als vollkommen willkürliches Beispiel herhalten muss. Die geschilderte Stelle ist ein Beleg für das Mehr, aus dem Texte außer ihrem Inhalt noch bestehen.
In einem Roman ist nicht eine Welt abgebildet, die es so oder so ähnlich geben könnte, sondern es gibt eine zwischengeschaltete Instanz. Der Erzähler erzählt lediglich von dieser Welt, die es so oder so ähnlich geben könnte. Und dieser Erzähler kann auch beschrieben werden, z. B. durch seinen Kontakt mit anderen Figuren der Erzählung – sofern er selbst Teil davon ist. Nimmt er dagegen nicht am Geschehen teil, charakterisiert er sich selbst, z. B. durch kleine kommentierende Einschübe. Ist etwa von einem „lächerlichen Kleid“ die Rede, trägt selbst ein einzelnes Wort wie „lächerlich“ zur Charakterisierung bei. Es wird schließlich etwas über den persönlichen Geschmack des Erzählers ausgesagt.
Auch kann der Erzählvorgang selbst kann charakterisiert werden, mal ausdrücklich, mal implizit. Der Erzähler kann ihn beispielsweise rechtfertigen: „Ich erzähle das, weil ich will…“ Oder er kann abschweifen und etwa philosophische Überlegungen zur Natur des Erzählens selbst anstellen („Immer wenn ich Geschichten wie diese erzähle…, geht es Ihnen nicht manchmal auch so?“). Mal wird auch der Prozess des Erzählens kommentiert („wie wir noch wissen“, „ich wiederhole noch einmal“ etc.) oder der Leser wird immer wieder als solcher angesprochen. Ein Erzähler hat unzählige Möglichkeiten, auf sein eigenes Erzählen einzugehen und es zu beschreiben, ohne die Handlung der eigentlichen Geschichte weiterzuspinnen.
Mal ist es dabei noch nicht einmal klar, welcher Redeanteil dem Erzähler zuzuschreiben ist und welcher den Figuren. Manchmal könnte man diskutieren, wem einzelne Wörter gehören, zum Beispiel das oben erwähnte „lächerlich“. Schildert ein gefühlskalter Erzähler die arme Figur? Oder hält sich die Figur selbst für lächerlich?
Diese Unklarheit darüber, wer nun was geäußert hat, ist schon allein aus ökonomischen Gründen sinnvoll – Bücher würden sonst aufgebläht zu dicken Wälzern. Auf der anderen Seite wird jedes Erzählen so, ob gewollt oder nicht, zu einem Erzählen über das Erzählen. Dadurch erinnern einen Autoren daran, dass Erzählen auch problematisch sein kann. Es ist immer subjektiv, immer ausschnitthaft und kann angezweifelt werden – wer ist schon zu 100 Prozent glaubwürdig? Ein allwissender Erzähler vielleicht? Selbst der findet sich in einer Vermittlungssituation gegenüber dem Leser wieder, aus der er nie ausbrechen kann.
Klar könnte man sich darauf beschränken, nur eine Geschichte zu erzählen und viele Autoren tun das auch. Sie berichten aus Ereignissen aus ihrem Umfeld, orientieren sich an realen Tatsachen, die auch der Leser kennt, formen sie um, laden sie sprachlich und ästhetisch auf. Andererseits machen sich viele Schriftsteller auch immer Gedanken, wie sie das am besten anstellen sollen.
Dabei gibt es über die Zeiten hinweg immer unterschiedliche Moden. Romantiker wie Brentano wählten durchaus auch mal den etwas direkteren Weg, dem Leser zu zeigen: Vorsicht! Das ist ja eigentlich alles gar nicht echt. Denkt doch mal drüber nach. Oder: Sogar meine Romanfigur hat meinen Roman gelesen. Wer kann schon sagen, was Fiktion und was Realität ist? Die Texte scheinen so kräftig, zauberhaft und bunt, dass eben selbst der Autor mit hineingesogen wird.
Foto: Antonio Litterio // CC BY 3.0
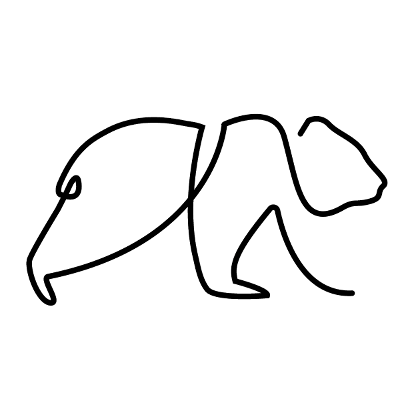

Kommentare 2